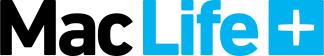/p>
Und man muss es doch auch einmal aussprechen dürfen: Als man sich als Band noch vor wenigen Jahren den ersten eigenen MySpace-Account anlegte, hatte man schon rasch vergessen, wie mühsam und unkomfortabel der Weg dorthin gewesen war. Dank des Portals hatte man eine eigene Homepage, hohe Suchmaschinenrankings sowie die Möglichkeit mit Tausenden von Kollegen und noch bedeutend mehr Hörern und potenziellen Käufern in Kontakt zu treten. Es war ein berauschendes Gefühl, sich einfach nur von einem Profil zum nächsten durchzuklicken und dabei die unvorstellbare Vielfältigkeit und Globalität von Kreativität nicht nur theoretisch zu erahnen, sondern sehen, spüren und vor allem natürlich hören zu können. Musik- und Medienexperte Andrew Dubber betonte auf seiner inzwischen weitgehend eingestellten Seite New-Music-Strategies, dass der interaktive Aspekt hinter diesem Element immer schon zurücktrat, sogar zu einem Zeitpunkt, als die öffentliche Meinung noch in eine andere Richtung tendierte: „MySpace war niemals Teil der Social-Media-Branche. Es war immer schon vornehmlich eine Seite für Musik. Nur hat das dort bis heute keiner begriffen.“ Aus Wut, Frustration und Enttäuschung über diese mangelnde Einsicht rief er 2009 dazu auf, MySpace noch ein Jahr Zeit zu geben, um die offensichtlichen Missstände zu beheben und sich der Verantwortung und Chance ihrer Monopolposition zu stellen. Als die „Deadline“ abgelaufen war, hatte sich denkbar wenig geändert. Zwar folgten nur wenige tatsächlich unmittelbar seinem Vorschlag eines kollektiven „Quit-MySpace-Day“. Doch der Gedanke hatte sich in ihrem Bewusstsein eingenistet wie ein Virus. Spätestens nach dem 27. Oktober erkannten Musiker und Labels selbst, was die Stunde geschlagen hatte – und der Exodus setzte ein.
Die Gründe für die Flucht sind vielfältiger Natur. Der Loop-Gitarrist und Social-Media-Kenner Marc Stevens indes bringt die Angelegenheit trefflich auf den Punkt: „Bei MySpace sieht man doch vor allem Bands, die sich gegenseitig anschreien. Es gibt da wirklich sehr wenig richtige Kommunikation. Wenn man so will, ist diese Seite zwar ein sozialer Treffpunkt – ohne dabei aber sozial zu sein.“ Er selbst hat sein Profil behalten, vor allem auch, weil er noch immer regelmäßig von Konzertveranstaltern darauf angesprochen wird. Doch steht für ihn fest, dass wohl jede vergleichbare Seite – und das gilt für die derzeit so populären Twitter und Facebook ebenso – ein inneres Ablaufdatum besitzt. Heute hat jeder Musiker die Auswahl aus einer Vielzahl an Plattformen, die sich viel spezifischer auf seine Bedürfnisse richten, als MySpace das jemals konnte: Bandcamp für den Eigenvertrieb von Musik, Snocap für die Verwaltung digitaler Rechte, Reverbnation für kompetente und maßgeschneiderte Marketing-Lösungen, SoundCloud für die Zusammenarbeit mit anderen Musikern, Remixe und Player, Facebook für die direkte Interaktion mit der eigenen Anhängerschaft. Eines aber haben all diese Seiten, wie Andrew Dubber einmal so richtig betont hat, nicht, wodurch MySpace sich einst in das große Buch der Musikgeschichte eintrug: „Jede verdammte Band auf diesem Planeten.“ Es war ein Pfund, mit dem sich wahrlich hätte wuchern lassen können, eine Basis für die größte und fruchtbarste Musik-Community, welche die Welt jemals gekannt hat. Diese Zeiten indes sind wohl endgültig vorbei – und es sieht nicht danach aus, als ob sie jemals zurückkehren würden.
von Tobias Fischer
- Seite 1: Digitale Kultur: MySpace
- Seite 2: Schlechter Groschenroman
- Seite 3:
- Seite 4: Berauschende Gefühle