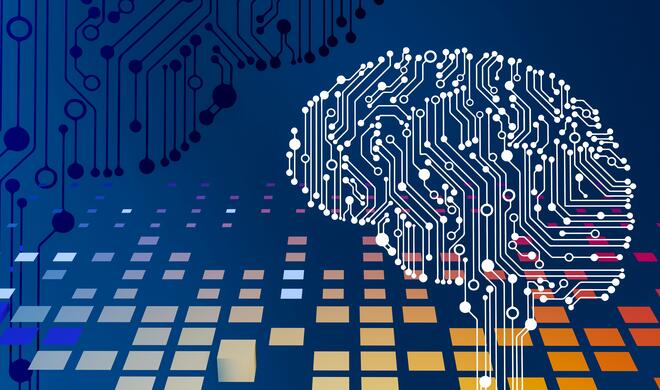Ein US-Gericht hat entschieden, dass Google seine lukrative Suchmaschinen-Partnerschaft mit Apple fortsetzen darf – jedoch unter strengeren Auflagen. Das Urteil von Richter Amit Mehta stellt einen wichtigen Meilenstein im Kartellverfahren gegen den Suchgiganten dar und bringt sowohl Erleichterung als auch neue Herausforderungen für beide Technologie-Konzerne.
- Google muss Chrome nicht verkaufen, da dies laut Richter zu chaotisch und riskant wäre.
- Die 20-Milliarden-Dollar-Zahlungen an Apple für Safari-Standard bleiben erlaubt.
- Exklusive Suchmaschinen-Verträge sind künftig verboten, Google muss Daten teilen.
Google darf Chrome behalten
Entgegen den Forderungen des US-Justizministeriums muss Google seinen Chrome-Browser nicht verkaufen. Richter Mehta begründete diese Entscheidung damit, dass eine erzwungene Veräußerung „unglaublich chaotisch und höchst riskant“ wäre. Chrome funktioniere nicht als eigenständiges Unternehmen und sei stark von Googles Infrastruktur abhängig. Eine Übernahme durch einen anderen Eigentümer würde laut Gericht wahrscheinlich zu erheblichen Produktverschlechterungen und Verlusten für die Verbrauchenden führen.
Das Justizministerium hatte argumentiert, Chrome sei ein wichtiger Zugangspunkt für Suchmaschinen, über den Google sich selbst bevorzuge. Mehta erkannte zwar an, dass Googles Standard-Status als Suchmaschine in Chrome „zweifellos zu Googles Dominanz in der allgemeinen Suche beiträgt“, sah aber keinen ausreichenden kausalen Zusammenhang zwischen der Monopolmacht und den Chrome-Standards.
Apple-Google-Deal bleibt bestehen
Die milliardenschwere Vereinbarung zwischen Apple und Google kann grundsätzlich fortgesetzt werden. Google zahlt Apple jährlich rund 20 Milliarden US-Dollar dafür, dass die Google-Suche als Standard-Suchmaschine in Safari voreingestellt ist. Richter Mehta entschied, dass ein komplettes Verbot solcher Zahlungen mehr Schaden als Nutzen anrichten würde.
„Das Kappen der Zahlungen von Google würde fast sicher erhebliche – in einigen Fällen lähmende – nachgelagerte Schäden für Vertriebspartner, verwandte Märkte und Verbrauchende verursachen“, erklärte der Richter. Ein Zahlungsverbot könnte Unternehmen wie Apple und Mozilla wichtige Einnahmen entziehen, während Google sein Geld behält und wahrscheinlich einen Großteil seiner Nutzerbasis beibehält.
Ein Kartellverfahren ist ein rechtliches Verfahren gegen Unternehmen, die ihre Marktmacht missbrauchen oder Monopole bilden. Ziel ist es, fairen Wettbewerb zu gewährleisten und Verbrauchende vor überhöhten Preisen oder eingeschränkten Wahlmöglichkeiten zu schützen. Die Behörden können Strafen verhängen oder strukturelle Änderungen wie Unternehmensaufspaltungen anordnen.
Neue Beschränkungen für Google
Obwohl Google weiterhin Zahlungen leisten darf, sind exklusive Verträge zur Suchmaschinen-Distribution künftig untersagt. Das Unternehmen muss außerdem bestimmte wertvolle Suchdaten mit Konkurrenten teilen, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Diese Maßnahme soll qualifizierten Wettbewerbern helfen, mehr Webseiten mit wertvollen Inhalten zu identifizieren und effizienter zu durchsuchen.
Die Datenfreigabe ist allerdings deutlich begrenzter als vom Justizministerium gefordert. Mehta gewährte nur eine eingeschränkte Auswahl an Suchdaten und nur eine einmalige Übertragung statt regelmäßiger Updates. Diese Beschränkung soll das von Google befürchtete „Trittbrettfahren“ minimieren.
Reaktionen und Ausblick
Die Entscheidung stößt auf gemischte Reaktionen. Kritiker wie die American Economic Liberties Project bezeichnen das Urteil als „Akt der Feigheit“, da es Googles Macht weitgehend intakt lasse. DuckDuckGo-Chef Gabriel Weinberg kritisierte, dass Google weiterhin sein Monopol nutzen könne, um Konkurrenten zu behindern.
Google plant, das ursprüngliche Monopol-Urteil anzufechten, wodurch sich der Fall noch jahrelang hinziehen könnte. Für Apple bedeutet die Entscheidung zunächst Planungssicherheit bei einer wichtigen Einnahmequelle. Das Unternehmen hatte bereits in seinen Quartalszahlen auf das Risiko hingewiesen, dass die Google-Vereinbarung enden könnte.
Die Entscheidung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem künstliche Intelligenz die Suchmaschinenlandschaft verändert. Apple-Manager Eddy Cue hatte vor Gericht erklärt, dass erstmals in 22 Jahren die Suchanfragen in Safari zurückgegangen seien – vermutlich aufgrund der zunehmenden Nutzung von KI-Tools. Apple erwägt daher, KI-Suchoptionen wie Perplexity in Safari zu integrieren.
Das Urteil markiert die bedeutendste kartellrechtliche Entscheidung gegen einen Technologie-Konzern seit etwa 25 Jahren und könnte Präzedenzcharakter für weitere Verfahren haben. Während Google seine Kerngeschäfte behält, muss das Unternehmen dennoch Änderungen vornehmen, die langfristig die Wettbewerbslandschaft im Suchmaschinenmarkt beeinflussen könnten.